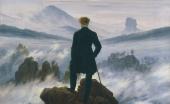Aureliano Milani, zugeschrieben
Aureliano Milani, zugeschrieben
Harzen hielt das Blatt noch für eine Arbeit von Carl Loth (1632–1698), doch lassen sich keine überzeugenden Parallelen zu dessen Zeichnungen aufzeigen. Die Darstellung von „Rebekka und Elieser am Brunnen“ ist sicher später entstanden, weshalb Wolf Stubbe 1957 eine Herkunft aus dem venezianischen Kunstkreis des 18. Jahrhunderts vorschlug. Allgemein wurde eine Ähnlichkeit zu Tiepolos Zeichnungen festgestellt, ohne dass dieser Künstler direkt als Urheber reklamiert wurde. Darüber hinaus wurde per anonymer Kartonnotiz – wenig einleuchtend – der Florentiner Giuseppe Zocchi (1711–1767) zur Diskussion gestellt.(Anm.1) 2005 schlug Andrea Czére Aureliano Milani als Zeichner vor und brachte das Blatt damit erstmals mit Bologna in Verbindung.(Anm.2)
Wie zeitgenössische Quellen berichten, genoss Milani im 18. Jahrhundert als Zeichner hohes Ansehen. Später ging das Wissen um sein Können weitgehend verloren. Viele seiner Zeichnungen lagen oder liegen in den Kabinetten unter falschen Zuschreibungen. Milani hat zahlreiche, häufig auch großformatige Blätter geschaffen, die als Vorzeichnungen, sei es für Gemälde, sei es für Kupferstiche dienten.
Gut vergleichbar mit dem Hamburger Blatt ist eine Zeichnung „Christus im Haus der Pharisäer“ im Crocker Art Museum in Sacramento.(Anm.3) Sie ist nicht nur in identischer Technik gezeichnet, sondern weist zudem ebenfalls eine längsrechteckige Komposition und ähnliche Gesichtstypen und Details (vgl. z. B. die Kopfbedeckung des Pharisäers und Eliesers) auf. Für die elastische Führung der Konturlinien finden sich Analogien auch auf einem Blatt in Windsor mit einer Darstellung des „Madonnenwunders von Forlí“. Häufig stimmen auf Milanis Zeichnungen die – seitenverkehrt angelegten – Figuren mit den späteren Umsetzungen überein. Da sich das Hamburger Blatt keinem bekannten Werk Milanis zuordnen lässt, handelt es sich – wie Andrea Czére vermutete – wohl um eine frühe Ideenskizze zu dem im 18. Jahrhundert häufig dargestellten biblischen Thema.
David Klemm
1 Notiz im Archiv des Kupferstichkabinetts.
2 Anlässlich des Symposiums „Italienische Altmeisterzeichnungen 1450 bis 1800“ am 27. und 28.10.2005 im Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle. Andrea Czére hat ihre Zuschreibung zudem schriftlich ausführlich begründet. Ihr ist für diese Informationen herzlich zu danken. Czére bereitet eine Publikation zu Milani als Zeichner vor.
3 Inv.-Nr. 1871.112. Das Blatt wurde ehemals Ludovico Carracci zugeschrieben. Vgl. Babette Bohn: Ludovico Carracci and the Art of Drawing, Turnhout 2004, S. 590, Nr. R 72.
Details zu diesem Werk
Beschriftung
Provenienz
Georg Ernst Harzen (1790-1863), Hamburg (L. 1244); NH Ad : 01 : 21, fol. 705 (als Carl Loth): "Elieser überbringt Rebekka die Geschenke. Feder in Seppia auf bl. Pap. Br. 20.7. h. 11.10."; Legat Harzen 1863 an die "Städtische Gallerie" Hamburg; 1868 der Stadt übereignet für die 1869 eröffnete Kunsthalle
Bibliographie
David Klemm: Italienische Zeichnungen 1450-1800. Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle, Die Sammlungen der Hamburger Kunsthalle Kupferstichkabinett, Bd. 2, Köln u. a. 2009, S.244-245, Nr.335
[Wolf Stubbe]: Italienische Zeichnungen 1500-1800. Ausstellung aus den Beständen des Kupferstichkabinetts, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle 1957, S.33, Nr.180